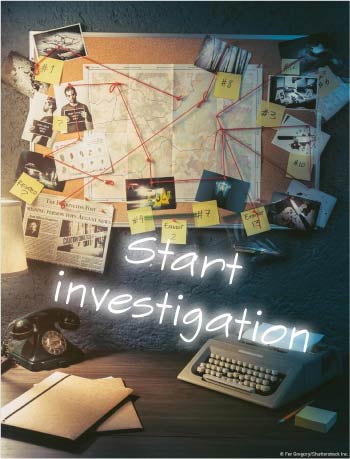Search
Judensau

Die Tiermetapher „Judensau“ bezeichnet ein im Hochmittelalter entstandenes häufiges Bildmotiv der antijudaistischen christlichen Kunst. Es sollte Juden verhöhnen, ausgrenzen und demütigen, da das Schwein im Judentum als unrein (hebräisch tame) gilt und einem religiösen Nahrungstabu unterliegt. Reliefs, Skulpturen und Bilder mit diesem Motiv sind seit 1230 belegt und an oder in rund 40 kirchlichen und anderen Gebäuden vor allem im deutschsprachigen Raum bis heute vorhanden.
Seit dem 15. Jahrhundert erschien das Motiv auch als aggressive Typenkarikatur in Druckwerken, seit dem 19. Jahrhundert auch als antisemitische Karikatur. Die deutschsprachigen Schimpfworte „Judensau“, „Judenschwein“ und „Saujude“ tauchen seit etwa 1819 auf. Die nationalsozialistische Propaganda griff diese Hetze und Verleumdung auf und bereitete damit auch den Holocaust vor.
Öffentlicher Gebrauch solcher Ausdrücke gegen Menschen ist in Deutschland als Beleidigung (§ 185 des Strafgesetzbuchs), in schweren Fällen auch als Volksverhetzung (§ 130) strafbar. Ähnliche Straftatbestände gelten in Österreich mit § 115 StGB und in der Schweiz mit der Rassismus-Strafnorm (Art. 261bis StGB).
Die hebräische Bibel begründet das Verhältnis von Mensch und Tier mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen: Indem JHWH Adam und Eva nach Gen 1,26 zu seinem Ebenbild beruft, ordnet er sie den Mitgeschöpfen über. Tiere und Pflanzen sollen den Menschen zugutekommen. Sie sollen alles Leben bewahren (Gen 2,15 ), aber nichts Geschaffenes mit Gott verwechseln (Ex 20,4 f. ). Die Tora verbietet Intimität zwischen Mensch und Tier (Zoophilie) als schwere Perversion und bedroht sie mit der Todesstrafe (Ex 22,18 ). Sie unterscheidet reine (wiederkäuende) und unreine (nicht wiederkäuende) Tierarten und verbietet das Opfern und den Verzehr der letzteren, darunter des Schweins (Lev 11,7 ; Dtn 14,8 ).
Ab der frühen Eisenzeit (~850 v. Chr.) ist das Schwein als Nahrungsmittel archäologisch nur im Küstengebiet der Philister, nicht im Siedlungsgebiet der Israeliten belegt. Spätestens nach dem babylonischen Exil (ab 539 v. Chr.) wurde das Toraverbot, Schweine zu opfern und zu verzehren, in Israel durchgesetzt und seine Übertretung scharf verurteilt, etwa in Jes 65,4 und Jes 66,3.17 . Damit grenzte sich das Judentum von im Hellenismus üblichen Schweineopfern ab. So wurde das Schwein im jüdischen Priestertum zum Symbol unerlaubter Opfer.
Der Seleukidenherrscher Antiochos IV. (175–164 v. Chr.) nahm das Verbot zum Anlass, die jüdische Religion zu verfolgen: Er befahl den Juden in seinem Herrschaftsbereich, Schweine zu opfern (1 Makk 1,47 ), und versuchte sie auch zum Essen von Schweinefleisch zu zwingen (2 Makk 6,18–31 ). Seitdem gehörte der völlige Verzicht auf Schweinefleisch zum unbedingten Bekenntnis eines gläubigen Juden. Darauf beruhen die im Talmud ausgeführten jüdischen Speisegesetze, wonach Schweinefleisch und Schweinemilch zur nicht koscheren Nahrung gehören.
Auch im Urchristentum blieb das Schwein ein Differenzmerkmal von Juden gegenüber Nichtjuden. Jesus von Nazaret lässt nach Mk 5,1–20 einen vielköpfigen Dämon namens Legion, der einen Menschen im nichtjüdischen Ort Gerasa beherrscht, in eine Schweineherde fahren, worauf diese sich ins Meer stürzt und ertrinkt. Der Name spielt auf die römische Fremdherrschaft an, weil eine in Gerasa stationierte römische Legion das Schwein als Legionszeichen trug und viele Juden sich damals wünschten, die Römer ins Meer zu treiben. Auch damalige Rabbiner benutzten das Schwein damals als kodierten Ausdruck für das gewalttätige Römische Reich, das Juden wie Urchristen gemeinsam verfolgte.
In Mt 7,6 warnt Jesus seine Jünger: „Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen.“ Gemeint war wohl, die kostbaren Worte der Tora und der Botschaft vom Reich Gottes nicht an nichtjüdische Verfolger von Juden und Urchristen zu verschwenden.
In 2 Petr 2,22 heißt es: „Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu: Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat, und: Die gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck.“ Das Sprichwort paraphrasiert Spr 26,11 , greift die im Judentum vorgeformte Paarung von Hunden und Schweinen auf und stellt den Abfall von Judenchristen zu einem habsüchtigen, gesetzlosen Lebensstil der Umwelt als unreines, verderbliches Verhalten dar. Vorausgesetzt ist Jesu Toraauslegung (Mt 5-7) als „Weg der Gerechtigkeit“ (2 Petr 2,20).
Schon einige Kirchenväter beschimpften Juden und Häretiker als solche als „Schweine“. Johannes Chrysostomos übertrug diese Herabsetzung im Jahr 388 in acht Hetzpredigten auf den jüdischen Gottesdienst in der Synagoge. Er verglich Juden wegen ihrer angeblichen schamlosen Bräuche mit Schweinen, Ziegen, lüsternen Zuchthengsten, Hunden, Hyänen und allgemein mit wilden Raubtieren, die nur töten könnten und die als sanfte Schafe kontrastierten Christen bedrohten. Dabei hielt er fest, dass Juden ihrem Wesen nach Menschen geblieben seien, wenn auch der übelsten Art. Andere verglichen Juden mit Katzen, Eulen und Skorpionen. Dabei ordneten sie den Christen die nach biblischer Kategorie „reinen“, den Juden die „unreinen“ Tierarten zu. Sie lobten ihre Allegorien als der wörtlichen jüdischen Bibelexegese überlegene, da mehrfache („wiederkäuende“) Auslegung. Diese verband Unreinheit mit moralischer und spiritueller Gefahr. Tiervergleiche machten diese Gefahr und die angeblichen moralischen wie intellektuellen Defizite der Juden anschaulich und ließen sich leicht in bildende Kunst übertragen.
Mit der Übernahme hellenistischer Tugend- und Lasterkataloge bildete die christliche Theologie seit dem 5. Jahrhundert die Reihe der „Sieben Todsünden“ heraus: Die letzten beiden, Völlerei (lateinisch gula) und Wollust (luxuria), wurden bildlich oft als Schwein symbolisiert. Es verkörpert die Unreinen und die Sünder, deren Bauch mit Schweinereien angefüllt ist, deren verdaute Exkremente sie ihren Nachkommen hinterließen (Ps 17,14 ). Ebenso verkörperten Mönche und Affen die inconstantia (Untreue, Unbeständigkeit). Rabanus Maurus stellte in seiner Enzyklopädie De universo (847) Juden Schweinen an die Seite, da beide in gleicher Weise ihre gottlose, sündhafte Unmäßigkeit und Unkeuschheit „vererbten“. Er bezog sich dabei auf die „Selbstverfluchung“ in Mt 27,25 : Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! Bis dahin wurden Juden mit Schweinen verglichen, nicht identifiziert, um einfache Christen mit drastischen Bildern vor analogen Lastern zu warnen. Der Schweinevergleich konnte dabei ebenso für eine sündhafte Religionsausübung wie für einen unsauberen, gefräßigen, von Promiskuität geprägten Lebensstil oder unlautere Geschäftspraktiken stehen.
Die seit dem 2. Jahrhundert üblichen christlichen Bestiarien schrieben Juden in moralisierenden Begleittexten Blindheit, Idolatrie und den Christusmord zu. Jedoch fehlt darin das spätere „Judensau“-Motiv. Dieses kam ohne Begleittext aus, beleidigte und verhöhnte Juden direkt, indem es sie mit dem am meisten verachteten Tier, mit Schmutz, Völlerei und Wollust identifizierte. Zwangskonvertierte Juden wurden in Europa nicht zum Schweinefleischverzehr genötigt, und kirchliche Quellen werteten das kultische Schweinefleischverbot für Juden nicht ab. Was die Verhöhnung dieses Verbots angeregt hat, ist ungeklärt.
Im Hochmittelalter stieg der Katholizismus zur herrschenden Weltanschauung Europas auf. Skulpturen an Kirchengebäuden stellten die siegreiche Ecclesia der unterlegenen Synagoge gegenüber (Ecclesia und Synagoge). Beide Figuren waren meist hoheitsvoll und wohlgestaltet. Während der Kreuzzüge (ab 1096) erhielt die Synagogenfigur auch vulgäre und pornografische Züge, etwa indem sie auf einer Sau gegen die Ecclesia reitet, die hoch zu Ross sitzt, oder sich mit der nackten Eva als Symbol von Unzucht, Erbsünde und Tod verbündet. Ab dem 12. Jahrhundert neigten christliche Theologen zur Gleichsetzung von Juden mit Tieren. Odo von Tournai erwog nach einer erfolglosen Disputation, ob sein Gegner wegen seiner sturen Abwehr des Christentums nicht eher unverständiges Tier als Mensch sei. Petrus Venerabilis bestätigte dies.
Im 13. Jahrhundert wurde die frühkirchliche Substitutionstheologie sozialpolitisch zementiert. Das 4. Laterankonzil von 1215 ordnete eine diskriminierende Kleiderordnung für Juden und ihren Ausschluss aus weltlichen Ämtern an. Das markierte sie als „Ungläubige“ und leitete ihre spätere europaweite Ghettoisierung ein. Im selben Zeitraum wurden Juden immer häufiger angeklagt, Ritualmorde und Hostienfrevel zu verüben. Neben solche Anklagen trat ab 1230 das bildhafte „Judensau“-Motiv in und an Kirchengebäuden.
Mittelalterliche Plastiken oder Wandbilder einer „Judensau“ stellen Menschen und Schweine in intimem Kontakt dar. Die menschlichen Figuren zeigen die typischen Kennzeichen der vom Laterankonzil 1215 verordneten Judentracht, etwa einen „Judenhut“ oder Gelben Ring. Oft saugen diese Figuren wie Ferkel an den Zitzen einer Sau, küssen, lecken oder umarmen Schweine. In anderen Varianten reiten sie verkehrt herum auf einem Schwein, das Gesicht dem Anus zugewandt, aus dem Kot und Urin spritzt.
Diese mitteleuropäischen plastischen Bilder gelten als früheste Form einer judenfeindlichen Karikatur, die drei sozialpsychologische Hauptzwecke erfüllte:
- die Juden dem allgemeinen Spott preiszugeben, indem auf ihre angeblich typischen Verhaltensweisen hingedeutet wurde;
- diese antijudaistischen Vorurteile der Betrachter zu verfestigen und zur Abgrenzung von Juden, indirekt so auch zum Handeln gegen sie zu ermuntern;
- die Juden in ihrem religiösen Selbstverständnis anzugreifen und zu verletzen.
Als grobe Spottbilder verbinden sie die Darstellung einer Intimität zwischen Mensch und Tier häufig mit Ausscheidungs- und Verdauungsprozessen. Die Obszönität der Bilder zielte auf eine möglichst wirksame Diffamierung der Dargestellten und sollte beim Betrachter Ekel, Schamgefühl, Hass und Verachtung hervorrufen. Dies sollte gläubige Juden in besonders quälender Form öffentlich verunglimpfen, demütigen und aus der menschlichen Gemeinschaft ausgrenzen. Dem Betrachter des Motivs wurde suggeriert, dass Juden besonders sündige, abstoßende, verkehrte und ausschweifende Dinge tun und mit Schweinen artverwandt seien. Das sprach ihnen ihre Menschenwürde ab, auf die es in ihrer Religion gerade ankommt. Zugleich zementierte das Motiv eine gesellschaftliche Distanz zur jüdischen Minderheit. Darum sehen Historiker darin einen Vorläufer des späteren Antisemitismus.
Die genaue Zahl der bildhaften „Judensau“-Darstellungen an Gebäuden ist ungewiss. 48 Beispiele in Mitteleuropa sind bekannt. Rund 40 davon sind noch vorhanden. Einige sind bis zur Unkenntlichkeit verwittert, andere waren nicht in Quellen verzeichnet und wurden erst ab 2000 wiederentdeckt.
Isaiah Shachar nannte in seiner maßgeblichen Forschungsarbeit zudem einige nicht oder nicht mehr vorhandene Beispiele aus teils unbestätigten literarischen Quellen:
- an einer Hauptkirche in Anhalt-Köthen,
- an Gasthöfen in Dessau, um Juden aus Berlin und anderswo von deren Besuch auszuschließen,
- in Diesdorf,
- in Torgau.
Die älteste bekannte „Judensau“-Skulptur entstand um 1230 als Säulenkapitell im Domkreuzgang von Brandenburg. Sie zeigt ein Mischwesen aus Schweinekörper und Menschenkopf, der den 1215 verordneten Judenhut trägt. Das deutete eine Wesensgleichheit von Jude und Schwein an. Diese Version wurde später nicht mehr aufgegriffen. Isaiah Shachar datiert auch die „Judensau“-Skulpturen in Bad Wimpfen, Eberswalde, Lemgo, Magdeburg und Xanten in das 13. Jahrhundert. Diese frühen Beispiele sollten ihm zufolge noch nicht das Judentum als solches verhöhnen, sondern Juden als moralische Exempelfiguren für alle Sünder darstellen.
In das 14. Jahrhundert datiert Isaiah Shachar die „Judensau“-Figuren in Colmar, Gnesen, Heiligenstadt, Köln, Metz, Nordhausen, Regensburg und Uppsala. Er bestritt ihre Herkunft aus dem Motiv der Kapitolinischen Wölfin, die Romulus und Remus säugt. Der Historiker Rudolf Reiser interpretierte die Regensburger Skulptur jedoch 2013 wegen ihres langen Schwanzes als säugende Wölfin.
Das Fries im Magdeburger Dom zeigt eine Figur, die ein Spitzhut als Jude markiert. Er kniet unter einer Sau und saugt an einer Zitze. Zwei Ferkel befinden sich rechts davon. Links ist ein bärtiger Jude dem Hinterteil der Sau zugewandt; seine abgebrochene rechte Hand berührte es wohl ursprünglich. Um die Ecke herum hält eine der Sau zugewandte Frau eine Schüssel mit Eicheln, ein Jude hält eine Schriftrolle.
Das Relief in St. Sebald (Nürnberg) zeigt vier männliche Figuren. Zwei hängen an den Zitzen einer Sau; eine davon trägt den Judenhut. Eine füttert links die Sau, eine fängt ihre Exkremente in einem Topf auf. Die Konsole sollte ursprünglich eine Heiligenfigur tragen.
Zwei Reliefs in Böhmen ahmen die schon etablierten deutschen Versionen nach. Die Figur in Kolín zeigt drei männliche Figuren mit Judenhut unter einer Sau; einer saugt ihre Zitze, einer hält ihren Schwanz, der dritte füttert sie. Dies symbolisiert wie die Magdeburger Figur die Sünde der Völlerei. Die Stadt gehörte zum Bistum Magdeburg und hatte anfangs großenteils deutschsprachige christliche Bewohner; Juden siedelten sich erst später dort an. Die Figur in der Schlosskapelle von Lipnice nad Sázavou ähnelt den Figuren in Bad Wimpfen, Bayreuth und Nürnberg. Sie ist von dämonischen Köpfen an weiteren Säulen umgeben, darunter dem Kopf des Teufels mit Grimasse, Stoßzähnen und herausgestreckter Zunge. Sie war aber hinter dem Altar platziert und daher kaum sichtbar.
Am Chorgestühl des Erfurter Doms wird der religiöse Gegensatz als Turnier dargestellt: Während die Kirche auf einem Pferd reitet, sitzt die Synagoge auf einem Schwein. Die Figur im flämischen Aarschot wandelt das Motiv ab: Dort reitet ein Jude auf einem Ziegenbock. Dieser war auch ein Teufelssymbol, so dass das Motiv nun bereits über den bloßen satirischen Spott hinausging und das Judentum insgesamt dämonisierte.
In Spanien wurden durch Zwangstaufen zum Christentum konvertierte Juden seit etwa 1380 als Marranos (Schweine) beschimpft, da man ihnen keine innere Abkehr vom Judentum abnahm und dies auf eine unveränderliche jüdische Wesensart zurückführte. Mit dem frührassistischen Kriterium der Blutsreinheit (limpieza de sangre) versuchten spanische Christen getaufte Juden vom gesellschaftlichen Aufstieg auszuschließen. Im 15. Jahrhundert kam es zu landesweiten Pogromen und Vertreibungen der spanischen Juden und Judenchristen. In Spanien wurden jedoch keine „Judensau“-Skulpturen nachgewiesen.
Ein 2019 im Kloster Heiligenberg bei Bruchhausen-Vilsen gefundenes Stempelsiegel aus dem 13. Jahrhundert zeigt einen Juden mit Spitzhut, der am Hinterteil einer Sau kniet, ein Hinterbein hält und seinen Mund ihrem After zuwendet. Der Historiker Konrad Elmshäuser las die Umschrift als SECRETUM IACOBI PIG BREMENSIS („Geschäftssiegel des Bremer Pfandnehmers Jacob“). Er vermutete, die Berufsbezeichnung Pignerator („Pfandleiher“) sei auf das englische Wort „Pig“ für „Schwein“ abgekürzt worden, um den bezeichneten Juden zusätzlich zu verhöhnen. Dagegen ordneten Andreas Lehnertz und Markus Wenninger das Siegel einem Christen zu und lasen seinen Namen in der Umschrift als Jakob Pil. Wer der Siegelführer war, wozu er dieses Siegel führte und warum das diffamierende Siegelbild gewählt wurde, sind ungeklärte Forschungsfragen.
Ab dem 15. Jahrhundert wurden derartige Bilder auch an nichtkirchlichen Bauten angebracht. Somit erweiterte sich der Adressatenkreis über den kirchlichen Rahmen hinaus in das Bürgertum; Juden wurden nun gesamtgesellschaftlich verachtet. Besonders provokant war das Wandbild am Frankfurter Brückenturm (um 1475): Es zeigte einen Rabbiner, der verkehrt herum auf einer Sau reitet, einen jungen Juden unter dem Bauch an den Zitzen, einen weiteren am After oder der Vulva saugend; hinter der Sau stehend den Teufel selbst und eine auf einem Ziegenbock reitende Jüdin. Darüber war der verstümmelte und gefolterte Simon von Trient als angebliches Opfer eines jüdischen Ritualmords zu sehen. Unter dem Bild stand: „Saug du die Milch, friß du den Dreck, Das ist doch euer best Geschleck.“ Dies sollte unterstreichen, dass Juden abartige Wesen seien, die den Tieren und dem Teufel näher stünden als dem Menschen. Die Verknüpfung des „Judensau“-Motivs mit der Ritualmordlegende sollte eine Pogromstimmung schüren. Das Bild befand sich direkt gegenüber der Frankfurter Judengasse und blieb bis zum Abriss des Brückenturms 1801 eine touristische Attraktion der Stadt.
Eine Steingravur an einem Privathaus in Kelheim von 1519 zeigte eine Sau, die als Juden gekennzeichnete Figuren zum Lesen einer Gebotstafel mit hebräischen Buchstaben bringen. Damit verhöhnte es den jüdischen Tora-Glauben. Die Inschrift darunter bezog es auf die damalige Vertreibung der Regensburger Juden. Das Bild wurde vor 1850 auf Klagen von Juden abgenommen, aber 1895 an die Fassade der Stadtapotheke verlegt. Als einziges öffentliches „Judensau“-Bild wurde es 1945 zerstört, auf Befehl eines Offiziers der US Army. Es ist nur noch auf Fotografien dokumentiert. Das Wandgemälde an einem Privathaus in Spalt war ursprünglich an der Bibliothek des Spalter Chorherrenstifts angebracht. Es zeigt einen Juden mit Spitzhut, der unter einer Sau liegt und an einer ihrer Zitzen saugt, während er mit einem Arm ein Vorderbein der Sau hochdrückt. Das Gemälde wurde bei einer Hausrenovierung 1969 verputzt, konnte aber wieder freigelegt werden.
Das Relief an der Wittenberger Stadtkirche kann schon mit deren Bau ab 1280 entstanden sein, wird aber oft ins 14. Jahrhundert datiert; ein Zusammenhang mit der Vertreibung der Juden aus Wittenberg (1304) wird vermutet. Es war ursprünglich Teil eines Bildzyklus im Altarraum zur Abwehr von Dämonen und Sünden. Die als Juden kenntlichen Figuren unter einer Sau standen für die Sünde des Irrglaubens und sollten Christen vor einer Konversion zum Judentum warnen, die nach damaligem Glauben ewige Verdammnis nach sich zog. Seit 1517 war die Stadtkirche Wittenberg der Predigtort Martin Luthers und Ursprung der Reformation. Seine Schmähschrift Vom Schem Hamphoras (1543) machte das Relief weithin bekannt. Folglich wurde es 1570 an die südliche Außenfassade der Stadtkirche versetzt und erhielt die Überschrift Rabini Schem HaMphoras (hebräisch „der unverstellte Name“). Das verknüpfte das für gläubige Juden unreine Schwein im Anschluss an Luther mit dem unaussprechlichen Gottesnamen. Diese Verbindung bedeutet für gläubige Juden eine ungeheure Blasphemie. In der frühen Neuzeit hatte sich der ursprünglich religiöse Gegensatz von Kirche und Synagoge also zu einer totalen, alle Lebensbereiche umfassenden Verachtung des Judentums verdichtet.
Die Skulptur an St. Nikolai in Zerbst entstand im Kontext einer lokalen Pest-Pandemie von 1448 und Pestpogromen an Judengemeinden.
Seit der Erfindung der Druckpresse (um 1440) findet sich das Motiv vermehrt auf Druckgrafiken und gelangte so mit anderen antijüdischen Stereotypen in die populäre Kunst. Ein zwischen 1450 und 1500 hergestellter und als Einblattdruck vervielfältigter Holzschnitt aus Breisach am Rhein gilt als erste profane Judenkarikatur. Sie zeigt eine riesige Sau, die vier Juden säugt und von drei weiteren umhegt wird. Zwei jüdische Zeugen im Begleittext legen nahe, es gehe dabei um sexuellen Verkehr, nicht um den Verzehr der Sau. Dies unterstellte Juden wie die textlosen älteren Skulpturen einen heimlichen Trieb zum Bruch der Toraverbote. Dagegen deuteten Juden das Schwein dieser Bilder weiterhin als Symbol der gewaltsam herrschenden Macht Roms.
Ein Kupferstich von 1475–1480 zeigt abstoßende Figuren mit dem gelben Ring, dessen Innenkreis mit einer Sau ausgefüllt ist. Sie schneiden ein nacktes Kind mit Messern und fangen sein Blut auf. Der italienische Untertitel verweist auf Simon von Trient. Das Bild verband das „Judensau“-Motiv erstmals mit der Ritualmordlegende und beeinflusste auch das etwas später entstandene Frankfurter Wandbild.
Der Prager Künstler Matouš illustrierte von 1490 bis 1495 ein Graduale und ein Hymnenbuch für Utraquisten in Kutná Hora mit farbigen Kalligrafien, die „Judensau“-Motive aufgreifen: Ein Mann mit blauem Hut reitet rückwärts auf einer Sau und hält ihren Schwanz fest in der linken Hand. Ein Mann mit Hut reitet im Turnierkampf eine Ziege, sein Gegner einen Eber oder eine Sau. Zwei Männer, einer mit blauem Hut, küsst das Hinterteil einer Ziege, der andere den After eines Schweins. Schon eine Bible moralisée von 1220 enthielt ein Bild eines Juden, der den Hintern einer Ziege küsst. Diese Motive beeinflussten auch deutsche Schandbilder: So zeigte die Anklageschrift gegen Dietrich von Klitzing (1550) eine Figur, die rückwärts auf einem Schwein reitet und den Mund auf dessen Anus presst.
Ein bis 1517 illustriertes Graduale für Utraquisten in Litoměřice zeigt im Folio zu Pfingsten biblische Szenen vom Toraempfang des Mose und Opfer des Elija. Das Rahmenwerk stellt blonde nackte Babys eines Menschenpaars einer Sau mit vielen dunkelbraunen Ferkeln gegenüber. Unter ihnen streckt ein Baby seine Hände zum Bauch der Sau und saugt an ihren Zitzen. Dies kontrastiert Christen als fruchtbare Erben des Alten Testaments mit Juden, die sich vom Schwein nähren und zu Ferkeln geworden sind. Das Bild symbolisierte und verstärkte lokale Konflikte zwischen Utraquisten und der jüdischen Gemeinde. Diese wurde 1541 bei einem Pogrom vernichtet; 1546 wurde Juden die erneute Niederlassung am Ort verboten.
Eins der 30 Holzreliefs, die Zacharias von Neuhaus von 1550 bis 1561 für den Goldenen Saal im Schloss Telč schnitzen ließ, zeigt einen bärtigen Mann im schwarzen Mantel mit dem gelben Ring. Er reitet eine fliegende Sau, hält ihren Schwanz fest in der linken, einen zerbrochenen Krug in der rechten Hand. Die deutsche Inschrift dazu („Veitl, ein Jude, ein Prüfer von Edelsteinen. Hier reitet er auf einer Sau. Er ist 60 Jahre alt.“) meint eine konkrete Person, eventuell den jüdischen Händler Feytl in Telč. Der zerbrochene Krug stellt ihn als Betrüger dar. Nach Feytls Tod 1561 mussten seine Söhne das Vaterhaus an den Schlossherrn verkaufen. Ob das Relief einen Privatkonflikt oder Judenhass ausdrückt, ist unklar.
Viele frühe Holzschnitte griffen das Frankfurter Wandbild auf und verschärften es. So zeigte ein Flugblatt von 1563 unter dem Titel „Der Juden Messias“ eine von zwei Teufeln begleitete Prozession von 14 Personen mit dem gelben Ring, die die „Judensau“ zur Hölle tragen. 13 der Figuren sind mit Namen und verunglimpfenden Reimen markiert.
Ab dem 16. Jahrhundert übertrugen Grafiken die assoziative Verbindung von Juden, Sau und Teufel auch auf Körpermerkmale und statteten die menschlichen Figuren etwa mit Schweinsohren, Bocksfüßen und Hörnern aus. Ein antijüdisches Pamphlet von 1571 etwa zeigt auf dem Deckblatt Judenfiguren mit dem Gelben Fleck, Teufelskrallen, Klauen- und Krähenfüßen und Schweinsgesichtern mit Hörnern und Geweihen. Eine davon, ein Gaukler mit Dudelsack, reitet auf einer Sau, die ihre Exkremente frisst. Auch auf „Judenspottmedaillen“ taucht das Motiv ab der Reformationszeit öfter auf.
Das Fastnachtsspiel von Hans Folz Ein spil von dem herzogen von Burgland (Werktitel: Der Juden Messias) aus dem 15. Jahrhundert zeigt die Aufnahme des Motivs in der deutschsprachigen Literatur. In diesem Bühnenstück wird der jüdische Messias szenisch als Antichrist entlarvt und am Schluss als Strafe für die Juden vorgeschlagen:
Die Szene bildet den dramatischen Höhepunkt des Spiels und gilt wegen ihrer Tabubrüche und Drastik als „eine der weitestgehenden antijüdischen Darstellungen in der volkssprachlichen Literatur des deutschen Mittelalters überhaupt“. Im Bild der „Judensau“ fasste Folz die dämonisch inspirierte „Verstocktheit“ der Juden, die aus damaliger christlicher Sicht die neue Heilsnahrung verweigern und stattdessen Exkremente und Erbrochenes, also im historischen und endzeitlichen Sinn Verdautes verzehren. Folz kannte die theologischen Stereotypen über Juden gut und transportierte sie in eine für sein Laienpublikum verständliche derb-komische, fäkal-obszöne Sprache, die das spätere antisemitische Schimpfwort „Saujude“ anbahnte.
Besonders wirksam war Luthers Schmähschrift Vom Schem Hamphoras von 1543. Darin deutete er das Wittenberger Relief wie folgt: „Hinter der Saw stehet ein Rabin, der hebt der Saw das rechte Bein empor, und mit seiner lincken hand zeucht er den pirtzel uber sich, bückt und kuckt mit grossem vleis der Saw unter dem pirtzel in den Thalmud hinein, als wolt er etwas scharffes und sonderlichs lesen und ersehen.“ Damit bezog Luther die „Judensau“ auf den Talmud und verhöhnte die Bibelauslegung der Rabbiner und den jüdischen Glauben insgesamt als schmutzige Lächerlichkeit. So schloss er jeden denkbaren theologischen Dialog mit Juden und die Anerkennung ihrer eigenständigen Religion aus. Luthers Verhöhnung regte zahlreiche Traktate über die „Judensau“-Skulpturen an.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die besonders populären „Judensau“-Darstellungen von Wittenberg und Frankfurt oft für antijüdische Zwecke in Büchern abgebildet und beschrieben. Dabei hat der Teufel meist eine als jüdisch angesehene Gestalt und trägt auch den Gelben Ring. Johann Jacob Schudt beschrieb das Frankfurter Bild 1714 in einem seiner antisemitischen Pamphlete: „…unter diesem Schwein liegt ein junger Jud / der die Zitzen saugt / hinter der Sau liegt ein alter Jud auf den Knien / und läst die Sau den Urin und anders aus dem Affter ihm ins Maul laufen.“ Achim von Arnim beschrieb dasselbe Bild in seiner Tischrede über die Kennzeichen des Judenthums (1811) so: „Auf einem Mutterschwein, das einen jungen Juden säugt, sitzt rücklings ein Rabbiner… ein anderer Jude horcht darunter hinein nach Prophezeiung, während die Jüdin sich an den Hörnern des Sündenbocks hält und von ihm zum Teufel geführt wird“. Arnim behauptete, die besten Maler Frankfurts hätten das Bild „durch zwey Jahrhunderte… immer neu aufgefrischt“, weil es „so allgemeynen Beifall“ gefunden habe. Er schlug vor, das Bild zur „Belustigung der Zwischenakte“ auf die Vorhänge des Berliner Schauspielhauses zu übertragen, um so jüdische Käufer der besten Logen dort zu demütigen. Johann Wolfgang von Goethe erwähnte jenes „große Spott- und Schandgemälde“ in seiner Autobiographie Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (1808–1838).
Die medial breit ausgefächerte antijüdische Propaganda im 19. Jahrhundert setzte eine etablierte, durch die älteren Bildzeugnisse verfestigte Assoziation von Juden mit Schweinen voraus. Das Schimpfwort „Judensau“ wurde in Volksliedern und Kinderreimen weitergetragen. Das Schimpfwort „Saujude“ wurde mit dem Hetzruf „Hep Hep“ durch die Hep-Hep-Krawalle von 1819 populär und auch mit Flugblättern und Spielkarten verbreitet. Es erschien ab 1861 mit vielen anderen antisemitischen Ausdrücken in der Wiener Kirchenzeitung. Prominente christliche Theologen bezichtigten Juden mit diesem Vokabular der revolutionären Erhebungen 1848 und forderten eine endgültige Lösung der „Judenfrage“. Das Schimpfwort wurde in Druckwerken der Folgezeit auch für Pogromaufrufe benutzt.
1852 veröffentlichte Alexander Schöppner in seinem „Sagenbuch der bayerischen Lande“ eine satirische Erzählung: Nachdem der Stadtrat von Heidingsfeld den örtlichen Juden das Anbringen des Stadtwappens an ihrer Synagoge verboten habe, hätten sie sich beim Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim darüber beklagt. Darauf habe er ihnen befohlen, sein Wappen, das zwei Säue enthielt, an ihrer Synagoge anzubringen. Der Rabbiner habe das befohlene Wappen für koscher erklären müssen; seither äßen die Heidingsfelder Juden gern Schweinefleisch. Die Erzählung beruht wohl nicht auf einem realen Vorgang, verdeutlicht aber die regionale Verachtung der Juden.
Während der gesetzlichen Judenemanzipation (1870–1890) im Deutschen Kaiserreich nahm die Tradition antisemitischer Karikaturen einen Aufschwung. Damalige politische Karikaturen verspotteten die Herrschenden, um über Machtverhältnisse aufzuklären und eine subversive Distanz in der Bevölkerung zu fördern. Dagegen richteten sich antisemitische Karikaturen gegen eine unterlegene Minderheit, die dem Betrachter als verabscheuungswürdig ausgeliefert und als Sündenbock angeboten wurde, etwa für die Wirtschaftskrise 1877. Damit wurden aktuelle Ereignisse aufgegriffen und in Form einer „personalen Typenkarikatur“ auf eine angeblich typische, dauerhafte Charaktereigenschaft aller Juden zugespitzt, die auf Ursachen in der jüdischen Kultur, Religion und einer angeblichen „Rasse“ verweisen sollte.
Im und nach dem Ersten Weltkrieg zeigten antisemitische Postkarten mit dem Titel „Levys Werdegang“ einen Juden, der auf einem Schwein reitend einem anderen Juden einen prall gefüllten Geldbeutel übergibt. Das typisierte Juden als angebliche „Kriegsgewinnler“, Profiteure des Krieges und der Kriegsniederlage.
Seit der Gründung der Weimarer Republik 1919 infolge der Novemberrevolution von 1918 beschimpften deutsche Rechtsradikale demokratische Politiker öffentlich als „Novemberverbrecher“ und als „Judensau“. So hetzte ein deutschnationales Stammtischlied von etwa 1920 gegen den damaligen Außenminister:
1922 wurde Rathenau gemäß dieser Aufforderung auf offener Straße erschossen.
Seit 1919 aktivierten die Nationalsozialisten die mittelalterlichen antijudaistischen Stereotypen, die das „Judensau“-Motiv mit Ritualmordlegenden, Motiven von Juden als „Blutsaugern“ und dem „Satan“ verbunden hatten, gezielt für ihre Propaganda. Damit bedrohten sie deutsche Juden schon in der Weimarer Zeit. So beschimpften und schlugen NS-Angehörige den Kaufmann Siegmund Fraenkel im Juni 1923 in einer Münchner Straßenbahn mit den Worten „Du Ostjude, du Saujude“ und verletzten ihn dabei so schwer, dass er zwei Jahre später an den Folgen starb.
Das 1923 gegründete NSDAP-Hetzblatt Der Stürmer übernahm und steigerte die Tradition antisemitischer Karikaturen zu Zerrbildern von Juden mit schiefen Zähnen, Tierklauen, triefenden Mundwinkeln und gierigem Blick, die Scharen junger blonder Mädchen verführten und „vergifteten“: Das verband religiöse mit pornografischen und rassistischen Motiven und bezog sie auf die „Rassenschande“ und das „Aussaugen“ der „arischen Rasse“. Oft verwendete der Stürmer in Titeln und Karikaturen das Bild vom „Judensaustall“, den es auszumisten gelte. In einer Stürmer-Karikatur vom April 1934 symbolisiert das Motiv die angebliche Medienmacht der Juden: Die mit einer Mistgabel durchbohrte Sau trägt die Aufschrift „Juden-Literatur-Verlage“, die Bildunterzeile lautet: Wenn die Sau tot ist müssen auch die Ferkel verderben. Als am Tropf der Verlage hängende „Ferkel“ sind Albert Einstein, Magnus Hirschfeld, Alfred Kerr, Thomas Mann, Erich Maria Remarque und andere dargestellt.
Diese Hetzpropaganda bereitete die Judenverfolgung der NS-Zeit vor, die mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 einsetzte und vom „Judenboykott“ (1. April 1933) an ständig gesteigert wurde. Seit den „Gesetzen zum Schutz des deutschen Blutes“ von 1935 waren Sexualkontakte zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen streng untersagt und für den männlichen Partner mit Haftstrafe bedroht. Nichtjüdische Frauen, die solcher „Rassenschande“ beschuldigt wurden, wurden öffentlich als „Judenhure“ gedemütigt, etwa indem man ihnen Schilder mit der Aufschrift um den Hals hängte: „Ich bin am Ort das größte Schwein und lass mich nur mit Juden ein.“ Überlebende Insassen nationalsozialistischer Konzentrationslager berichten von sadistischen Ritualen mancher Aufseher der SS: Sie zwangen jüdische Häftlinge etwa dazu, sich zu entkleiden und von einem Baum herab zu rufen: „Ich bin eine dreckige Judensau!“ SA-Leute misshandelten und quälten den Nichtjuden Carl von Ossietzky 1936 im KZ Sonnenburg wochenlang unter Rufen wie „Jude“, „Judensau“ und „Sau“. Er starb 1938 auch an den Folgen dieser Folter.
Edgar Kupfer-Koberwitz, überlebender Häftling des KZ Dachau und Autor der Dachauer Tagebücher, beschrieb die sadistische und traumatisierende Folter der KZ-Aufseher, die einen Häftling beim Hofappell als „Saujud“ und „Judensau“ anbrüllten und stundenlang quälten, und die eigene Ohnmacht im hilflosen Versuch, dem Gequälten beizustehen, in seinem Gedicht „Erinnerung“.
Karena Niehoff, eine „Halbjüdin“, war 1950 Hauptzeugin im Prozess gegen Veit Harlan, den Regisseur des NS-Propagandafilms Jud Süß von 1940. Sie belastete ihn mit der Aussage, er habe den Drehbuchentwurf eigenhändig antisemitisch verschärft. Sie wurde darauf vom Publikum als „Judensau“ beschimpft und bedroht, so dass sie Polizeischutz brauchte und die Öffentlichkeit fortan vom Prozess ausgeschlossen wurde. Die Drohungen gegen sie, weitere Prozessumstände und der Freispruch für Harlan wurden in den Medien weltweit beachtet und vielfach als Zeichen mangelnder Vergangenheitsbewältigung in der Nachkriegszeit in Deutschland bewertet, so dass Bundeskanzler Konrad Adenauer den Vorfall öffentlich bedauerte.
Der Umgang mit den historischen „Judensau“-Darstellungen ist umstritten. Denkmalpfleger und Historiker wollen auch äußerst anstößige Motive als Zeitzeugnisse in ihrem damaligen architektonischen Kontext dokumentieren. Kritiker wollen diese Bilder entfernen lassen, weil sie mangelnde Sensibilität gegenüber heutigen Juden und mangelnde Abkehr vom Antisemitismus darin sehen. Zumindest fordern sie eine deutliche Distanzierung in Begleittexten.
Der Aktionskünstler Wolfram P. Kastner thematisierte die Judensau am Chorgestühl des Kölner Domes bei einer Protestaktion 2002 als „Modellfall für die Produktion von Gewaltbildern in unseren Köpfen“. Die Melanchthon-Akademie Köln richtete dazu eine Tagung aus und forderte zwar keine Entfernung des Schnitzwerks, aber eine Auseinandersetzung mit diesem „exemplarischen Gewaltbild“ in der Kirche. Die Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner lehnte eine distanzierende Hinweistafel und die Thematisierung des kirchlichen Judenhasses als „absurd“ ab, weil das Chorgestühl auch judenfreundliche Schnitzereien enthalte. Sie verwies auf eine benachbarte Steinplatte zum „Judenprivileg“ von 1266, das die Kölner Juden dem besonderen Schutz des Erzbischofs unterstellte. Auf diesen Schutz verweist auch der Kunsthistoriker Marc Steinmann im Domkatalog. Trotz des Schutzprivilegs, das damalige Kölner Juden teuer erkaufen mussten, folgten Pogrome an ihnen, etwa in der Pestepidemie 1348/49. 2017 lehnte Dombaumeister Peter Füssenich auch für den Wasserspeier eine Erklärtafel ab, bejahte aber Führungen und Texte im Domblatt dazu.
Das Bistum Regensburg lehnte eine Hinweistafel am Regensburger Dom zunächst ab. Im Mai 2004 hinderte Polizei die Aktionskünstler Wolfram Kastner und Günter Wangerin daran, mit Wasserfarbe „Judensau“ auf das Pflaster vor dem Dom zu schreiben. Danach verlangten auch die israelitischen Kultusgemeinden in Bayern ein Hinweisschild zum Relief am Dom. Am 30. März 2005 stellte der Freistaat Bayern, Eigentümer des Regensburger Doms, eine Texttafel vor: „Die Skulptur als steinernes Zeugnis einer vergangenen Epoche muss im Zusammenhang mit ihrer Zeit gesehen werden. Sie ist in ihrem antijüdischen Aussagegehalt für den heutigen Betrachter befremdlich. Das Verhältnis von Christentum und Judentum in unseren Tagen zeichnet sich durch Toleranz und gegenseitige Achtung aus.“ Historiker kritisierten diesen Text als die Geschichte glättend, verharmlosend und belanglos. Am 11. Mai 2005 hängten Kastner und Wangerin einen Gegenentwurf an die Domwand, der die christliche Mitschuld benannte. Ihre Tafel wurde am selben Tag entfernt. 2014 entfernten Unbekannte die umstrittene offizielle Texttafel.
Im Februar 2019, zum 500. Jahrestag der Vertreibung der Regensburger Juden, eröffnete das städtische Kulturreferat die Ausstellung Regensburg – Mittelalterliche Metropole der Juden. Für den gleichnamigen Katalog hatte die Historikerin Eva Haverkamp-Rott die „Judensau“-Skulptur eingeordnet: „Das Gebot, nach dem Juden kein Schweinefleisch essen, wird hier zur Absurdität verkehrt. Diese ekelerregende Propaganda degradierte die Juden und war ein Angriff auf die jüdische Religion.“ Stattdessen stand in der Druckvorlage der Tafeltext von 2005. Die Historikerin protestierte: Kulturreferent Klemens Unger habe den Text gegen ihren Willen gestrichen, dadurch die Skulptur verharmlost und das ganze Kapitel zur mittelalterlichen Judenverfolgung verfälscht. Daraufhin erschien der Katalog im Juli 2019, sechs Wochen nach dem Ende der Ausstellung, ganz ohne die Passage zur „Judensau“. Dies kritisierten Katalogautoren und Medienberichte als unerlaubten und sinnverändernden Eingriff: „Zu so einem unangenehmen Erbe wie der ‚Judensau‘ am Regensburger Dom zu stehen, hieße, die in der Wissenschaft unstrittige Tatsache anzuerkennen, dass der über 1000 Jahre lang von der Kirche systematisch angeheizte Hass auf die Juden die Basis war, auf der die Nazis aufbauen konnten, auf der Auschwitz möglich war.“
Im Januar 2022 einigte sich das Bistum Regensburg mit der jüdischen Gemeinde und dem Freistaat Bayern auf einen von Eva Haverkamp-Rott verfassten neuen Text für eine Hinweistafel, der auch Vorlage für andere Orte sein soll. Der Text stellt den historischen Zweck der Judensauskulpturen, die Dämonisierung des Judentums, und ihre mörderischen Folgen heraus: „Mit dieser menschenverachtenden Propaganda wurden Jüdinnen und Juden zu Feinden des Christentums erklärt. So wurde über Jahrhunderte Hass gegen sie geschürt. Ausgrenzung, Verfolgung bis hin zum Mord waren die Folge. Heute soll diese Skulptur alle Menschen mahnen, gegen jede Form von Propaganda, Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus vorzugehen.“ Im Januar 2023 wurde die Hinweistafel mit dem einvernehmlich beschlossenen Text in deutscher und englischer Sprache außen am Regensburger Dom angebracht. Weitere Informationen im Internet sind über einen QR-Code auf der Tafel abrufbar.
1983 wurde die Stadtkirche Wittenberg renoviert. Dabei beschloss der Gemeinderat, das „Judensau“-Relief an der Kirchenmauer zu lassen. 1988 entwarf der Bildhauer Wieland Schmiedel im Auftrag der Gemeinde eine Gedenkplatte, die unterhalb des Reliefs in den Boden eingelassen wurde. Sie verweist auf den Holocaust als historische Folge dieses Judenhasses. Ihre Trittplatten sollen etwas verdecken, das jedoch aus allen Fugen hervorquillt. Der umrahmende Text zitiert auf Hebräisch Ps 130,1 („Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“), auf Deutsch den Berliner Schriftsteller Jürgen Rennert: „Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Schem Ha Mphoras, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen.“
Im Herbst 2016 forderte der Londoner Theologe Richard Harvey im Internet die Abnahme der Skulptur zum Reformationsjubiläum 2017. Seine Petition fand rasch 5000 Unterstützer. Der Zentralrat der Juden in Deutschland befürwortete die Abnahme oder eine bessere Erläuterung; die vorhandene Tafel sei unzureichend. Die evangelische Landesbischöfin Ilse Junkermann lehnte die Abnahme ab: Die Kirche müsse „diese Wunde unserer eigenen Geschichte offen halten“ und könne sie nicht selbst zurechtrücken. Die Skulptur müsse als „Erinnerungs- und Mahnzeichen“ dafür stehenbleiben, dass die Kirche nichts beschönigen wolle, sondern die Kraft der Vergebung erhoffe. Die Bodenplatte darunter liefere die notwendige Einordnung.
Im Mai 2017 gründete der Leipziger Pastor Thomas Piehler ein „Bündnis zur Abnahme der ‚Judensau‘ im Reformationsjahr 2017“. Die Evangelische Marienschwesternschaft Darmstadt unterstützte es maßgeblich. Es demonstrierte 2017 jede Woche mit einer stillen Mahnwache auf dem Wittenberger Marktplatz dafür, die Skulptur abzunehmen und in ein Museum zu bringen. Dagegen veröffentlichte der Kreisvorsitzende der rechten Alternative für Deutschland (AfD) eine Petition zum Erhalt der Skulptur und beantragte dazu einen Beschluss des Stadtrats. Dieser diskutierte im Juni 2017 darüber und entschied im Juli 2017 ebenso wie zuvor der Gemeindevorstand, die Skulptur an der Kirchenwand zu belassen. Noch vor dem Reformationsjubiläum 2017 wurde das Relief mitsamt der Überschrift frisch vergoldet, auch mit öffentlichen Geldern.
2018 erhob Michael Düllmann, ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Deutschland, eine Zivilklage mit dem Ziel, das Relief von der Stadtkirche Wittenberg entfernen zu lassen. Ein Vergleich zwischen den Streitparteien scheiterte an den auf 10.000 Euro geschätzten Kosten für die Abnahme des Reliefs. Im Mai 2018 verwies das Amtsgericht Wittenberg den Fall wegen des hohen Streitwerts an das Landgericht Dessau-Roßlau. Dieses entschied am 24. Mai 2019: Das Relief sei Teil des historischen Baudenkmals der Stadtkirche und weder als Missachtung der Juden in Deutschland noch als Beleidigung des Klägers zu verstehen. Das ganze Kirchengebäude mitsamt dem Relief stehe unter Denkmalschutz. Am 4. Februar 2020 wies das Oberlandesgericht Naumburg die Berufung zurück: Die Stadtkirchengemeinde habe das Relief in ein Gedenkensemble eingebunden und sich mit einer Informationstafel unmissverständlich vom Antijudaismus der Skulptur und Luthers Schriften distanziert. Damit entfalle die Gefahr, die Plastik als Teil der christlichen Verkündigung misszuverstehen. Der Wunsch des Klägers, die Skulptur in ein Museum zu verlegen, widerspreche seinem Argument, auch eine kommentierte Beleidigung bleibe eine Beleidigung.
Der Kläger hatte im Prozess argumentiert, solange das Relief an der Kirche hänge, sei es Teil der christlichen Verkündigung und damit ein Angriff auf Juden. Der Text der Bodenplatte verfälsche zudem die Geschichte: Die Juden seien in der Shoa nicht gestorben, sondern ermordet worden, und hätten nicht das Kreuzeszeichen, sondern den Davidstern tragen müssen. Der Text vereinnahme Juden als christliche Märtyrer. An der Kirchenwand behalte das Relief eine aufhetzende Wirkung, im Museum diene es der Aufklärung. Doch daran sei die Kirchengemeinde nicht interessiert. Dagegen erklärte der Gemeinderat, von einer mehr als 700 Jahre alten Schmähskulptur lasse sich kaum „die Verbundenheit einer davon betroffenen Gruppe“ ableiten. Es handle sich „nur noch um einen geschichtlichen Vorgang“, dessen Kontext die Informationstafel erkläre. Daher sei zu fragen, ob man nicht einen „zeitlichen Trennungsstrich“ ziehen müsse.
Am 14. Juni 2022 wies der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision des Klägers zurück: Das Relief sei zwar bis 1988 beleidigend gewesen, könne aber an der Stadtkirche bleiben, weil die Kirchengemeinde sich seither ausreichend distanziert habe. Mit der Bodenplatte und einem aufgestellten Erläuterungstext habe sie das „Schandmal“ in ein „Mahnmal“ zum Gedenken umgewandelt.
Begleitend zum Prozess wiesen mehrere Kommentatoren die Argumente zur Beibehaltung zurück. Arno Tausch betonte, das Relief sei „kein Kunstwerk, sondern schlicht und einfach Teil der Hass- und Vernichtungspropaganda, die schließlich zur Shoah führte“. Dmitrij Kapitelman betonte: Niemand müsse künstlerisch an historischen Hass erinnert werden, der Juden noch immer treffe. Kunstwerke, die nur Vorurteile transportieren, seien wertlos. Sonst könne man auch wieder ein Hakenkreuz im Reichstagsgebäude als kunsthistorisches Denkmal aufhängen. An Synagogen oder Moscheen würde eine ähnlich obszöne Marienstatue nie hängen bleiben, weil dies unweigerlich Selbstmord für die Gemeinde wäre. Die „Judensau“ müssten vor allem die in Deutschland übrig gebliebenen Juden aushalten, nicht die Christen. Das zeige: „Wenn das Schwein bleibt, ist es eine Machtdemonstration dafür, wer in diesem Land die Schmerzgrenzen zieht.“
Im Mai 2019 plädierten die Präses der EKD-Synode Irmgard Schwaetzer, Landesbischof Friedrich Kramer, der Generalsekretär der evangelischen Akademien in Deutschland Klaus Holz und der Kläger Michael Düllmann gemeinsam dafür, die Skulptur von der Kirchenwand abzunehmen und in ein neues Denkmal vor der Kirche zu integrieren. Dieses solle die Gemeinde mit den jüdischen Institutionen zusammen gestalten und die Kommune und der Landkreis mittragen. Denn die Skulptur bleibe auch mit der Kommentartafel eine Beleidigung. Die nachträgliche Inschrift zum Gottesnamen drücke reinen Judenhass aus. Dazu müssten sich die evangelischen Christen aktuell wieder verhalten und auch an die Gefühle der jüdischen Betrachter denken. Im Februar 2020 forderte Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, die Skulptur ins Museum zu bringen. Dagegen befürwortete der Antisemitismusbeauftragte in Sachsen-Anhalt Wolfgang Schneiß eine von allen Streitparteien getragene „behutsame Weiterentwicklung“ des Mahnmals, etwa 2021 im Rahmen der bundesweiten Erinnerung an „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Ronen Steinke kritisierte, dass die Gerichte nicht auf den Text der Bodenplatte von 1988 eingegangen waren, und stellte dessen Aussagekraft in Frage: „Gottes Name ‚starb‘? Er starb ‚in‘ Juden? Wie charmant finden Juden solche Sätze?“
Der Zentralrat der Juden in Deutschland fand das BGH-Urteil nachvollziehbar, aber unklar, inwiefern die Begleittexte an der Kirche die Skulptur in ein Mahnmal verwandelten. Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees bedauerte das BGH-Urteil, weil das jahrhundertealte Schandmal an einem der wichtigsten Orte des Protestantismus das Verhältnis zwischen Juden und Christen bis heute belaste. Charlotte Knobloch, die langjährige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, fand es allgemein unbegreiflich, Menschen wegen volksverhetzender Beiträge im Internet zu bestrafen, die bildhafte Umsetzung derselben Hetze aber als kulturhistorisch wertvollen Beitrag zu schützen. Gerade wegen der Kontinuität des Judenhasses hätten die Kirchen diese Skulpturen längst entfernen und in Museen überführen sollen.
Der Pfarrer der Stadtkirche Alexander Garth kündigte für den Herbst ein Gedenkkonzept an, das jeder Besucher sofort erfassen könne. Niklas Otterbach (Deutschlandfunk) kritisierte die Argumentation der Kirchengemeinde als „selbstbezogene Geschichtsbetrachtung, die zwar die eigenen Untaten thematisiert wissen will, aber die Wirkung auf die, die damit beleidigt werden, ausblendet.“ Geschichte und damit das Stadtbild entwickelten sich weiter. Man könne nicht behaupten, im Museum gehe die öffentliche Debatte um die „Judensau“ verloren. Die Theologin Margot Käßmann kritisierte das BGH-Urteil als „falsche Entscheidung“, weil die Skulptur auch heutige Juden beleidige: „Die ‚Judensau‘ ist eine Hassbotschaft. Und Hassbotschaften gehören nicht in den öffentlichen Raum.“
Im Juli 2022 lud der Gemeinderat eine Expertenkommission ein. Diese empfahl, das Relief der „gegenwärtigen Sichtbarkeit“ zu entziehen und es entweder zu verdecken und ein Faksimile samt Erläuterungen und Gedenktexten nahe der Kirche auszustellen, oder das Original von der Kirchenwand abzunehmen und an jenen noch zu schaffenden Ausstellungsort zu bringen. Im August 2022 reichte der Kläger Michael Düllmann eine Verfassungsbeschwerde gegen das BGH-Urteil ein. Im selben Monat baten 50 israelische Wissenschaftler den Wittenberger Gemeinderat per Brief, die Skulptur an der Kirchenwand zu belassen und vor Ort über das Verhältnis von Christen und Juden im Mittelalter aufzuklären. Die Entfernung in ein Museum käme einer Leugnung dieser Vergangenheit gleich. Am 30. August 2022 beschloss der Gemeinderat für das Relief einen neuen Erklärtafeltext, der laut Pfarrer Alexander Garth „erstmals das jüdische Volk um Vergebung“ bat und sich eindeutig gegen Antijudaismus und Antisemitismus aussprach. Am 26. Oktober 2022 entschied der Gemeinderat gegen den Expertenrat, das Relief als Ganzes sichtbar an der Kirchenmauer zu lassen, aber die Bitte um Vergebung ins Zentrum des Erklärtextes zu stellen und ein pädagogisches Konzept zur Aufklärung über die Geschichte des Reliefs zu entwickeln.
Dagegen forderte Landesbischof Ralf Meister am Reformationstag (31. Oktober) 2022, man solle die Skulptur „nicht nur entfernen, sondern radikal vernichten, zerstören und kaputt machen“. Es gebe mehr als genug Lernorte für Antisemitismus. Meister revidierte damit seine frühere Meinung, das Relief mit einer Einordnung zu erhalten, nach vielen Gesprächen mit Jüdinnen und Juden, „die das Relief weiterhin unerträglich finden.“
Die Initiatorin des Bittbriefs vom August 2022, die Kunsthistorikerin Galit Noga-Banai (Hebräische Universität Jerusalem), erklärte im April 2023: Anders als der Kläger Düllmann hätten BGH und Gemeinderat wie schon Luther begriffen, „dass das Relief an der Kirchenmauer klar und deutlich mit den Menschen, Ereignissen und anderen Kunstwerken in der Kirche und ihrer Umgebung kommuniziert.“ Die Gedenkplatte darunter erinnere bleibend an die antisemitische Wirkung des Reliefs bis zur Shoa; sie habe das „Kunstwerk vor der Beseitigung und Musealisierung bewahrt“ und sei „mit diesem gemeinsam zu einem Ruf nach Versöhnung“ geworden.
Im April 2023 forderte Felix Klein, die Stadtkirche Wittenberg von der Liste des UNESCO-Welterbes zu streichen, weil die Verunglimpfung von Religionen mit den Unesco-Grundprinzipien unvereinbar sei. Im August 2023 forderte er, die Skulptur abzunehmen, sonst sei Wittenberg kein geeigneter Standort für das von der Bundesregierung geplante deutsch-israelische Jugendwerk.
In Zerbst wurde Anfang 2022 eine Erklärtafel unter der Skulptur aufgehängt. Die Kirchengemeinde, ein Förderverein und die Evangelische Landeskirche Anhalts planten ein Gegendenkmal und erhielten dazu bis März 2022 zehn künstlerische Entwürfe. Ausgewählt wurde eine als Lesepult wie in einer Synagoge gestaltete Stele des Bildhauers Hans-Joachim Prager. Ihre Stirnseite zitiert oben Art. 1 des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar“), unten den Bibelvers Gen 1,27 („Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde“). Alle vier Seiten führen die Namen der NS-Opfer unter Zerbster Jüdinnen und Juden auf. Am 1. Juni 2023 enthüllte Landeskirchenpräsident Joachim Liebig dieses Gegendenkmal. Dabei benannte er den Antisemitismus als jahrhundertelange Schuld des Christentums und bat alle dessen Opfer um Vergebung, „wohlwissend, dass das Leid damit nicht geschmälert wird“. Nach dem Wunsch des Bildhauers soll die Stele einen gesellschaftlichen Toleranz-Diskurs fördern; um sie herum könne ein Ort der Versöhnung, ein Friedensplatz entstehen.
In Bayreuth forderte der Pfarrer Klaus Rettig seit 2000 die Entfernung der stark verwitterten „Judensau“-Skulptur. Der Kirchenvorstand der Stadtkirche lehnte ab und beschloss stattdessen im Oktober 2004 eine Gedenktafel dazu. Eine Woche danach zerschlugen Unbekannte die Skulptur. Die Gedenktafel wurde 2005 angebracht und trägt die Inschrift: „Unkenntlich geworden ist das steinerne Zeugnis des Judenhasses an diesem Pfeiler. Für immer vergangen sei alle Feindseligkeit gegen das Judentum.“
In Cadolzburg forderten Bürger im Juli 2003 bei einer Aktion Wolfram Kastners eine unmissverständliche Distanzierung der Stadt vom „Judensau“-Relief am Burgtor. Der Bürgermeister versuchte die Kundgebung mit Polizei und Feuerwehr zu verhindern. Nachdem der Zentralrat der Juden in Deutschland Kastners Initiative unterstützt hatte, ließ Bayerns damaliger Finanzminister Kurt Faltlhauser im Januar 2004 eine Informationstafel bei dem Relief anbringen.
In Nürnberg beschloss der Kirchenvorstand von St. Sebald am 15. September 2005, dem 70. Jahrestag der Nürnberger Gesetze, eine Erklärung: „Das ‚Judensau‘-Schmähbild aus dem Spätmittelalter drückt den Judenhass aus, der die Schoa vorbereitet hat. Im selben Ungeist sind jüdische Bürger Nürnbergs bis ins 20. Jahrhundert verachtet und verteufelt, vertrieben und vernichtet worden. Voller Scham verbeugen wir uns vor den Millionen Opfern des Judenhasses. Wir bitten sie und unseren gemeinsamen Gott um Vergebung.“ Die Erklärung wurde in einem Faltblatt abgedruckt, aber nicht als Tafel an der Außenmauer angebracht.
Im August 2017 verwies Morten Freidel (FAZ) auf fehlende Hinweistafeln zu den Skulpturen in Calbe, Eberswalde, Köln und anderswo sowie auf Argumente betroffener Juden für den Erhalt der Skulpturen: Salomon Korn, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, plädierte für „Aufklärung vor Beseitigung“. Die aktive Auseinandersetzung mit historischen antisemitischen Phänomenen und Personen sei wichtiger als deren bloße Entfernung aus dem öffentlichen Raum. Im Originalkontext an Kirchen könne man mehr darüber lernen als im Museum. Nur in extremen Ausnahmefällen solle man die Skulpturen entfernen. Josef Schuster (Zentralratspräsident) wollte Kirchengemeinden vor die Wahl stellen, die Skulpturen zu entfernen oder eindeutige Erklärtafeln anzubringen. Andere deutsche Juden wollten die Skulpturen an Kirchen erhalten, um diese nicht aus ihrer Verantwortung für ihre Geschichte zu entlassen. Die Entfernung würde den genuinen, im Christentum angelegten Antijudaismus unsichtbar machen.
In Bayern entschieden im Dezember 2020 der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden, Kirchen- und Staatsvertreter wie der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle einstimmig, die rund 12 antijüdischen Plastiken an Kirchen hängen zu lassen, sie aber „sichtbar und gut erkennbar“ vor Ort einzuordnen.
In Calbe wurden 2019/2020 vierzehn historische Wasserspeier der St.-Stephani-Kirche mit Landesmitteln restauriert, darunter die „Judensau“-Skulptur. Diese wurde auf Beschluss des Gemeinderats danach nicht wieder angebracht. Pfarrer Jürgen Kohzt erklärte dazu: Die Figur beleidige Menschen anderen Glaubens; eine Erläuterungstafel wie die in Wittenberg ändere daran nichts. Die Denkmalbehörde lehnte die Abnahme des Reliefs in Calbe jedoch ab und erzwang, dass sie im Juni 2020 wieder angebracht wurde. Die Gemeinde beschloss daraufhin, die Figur vorläufig zu verhüllen, wollte die Abnahme aber weiterverfolgen und juristisch prüfen lassen.
Das Domkapitel Brandenburg diskutierte im Frühjahr 2023 einige Monate lang über den Umgang mit der Schmähplastik im Kreuzgang des Doms. Am 14. Mai 2023 folgte es der einstimmigen Empfehlung einer Expertengruppe und beschloss, die Plastik dort hängen zu lassen, aber künftig zu verhüllen. Wie Bischof Christian Stäblein erläuterte, ließ sich das Relief wegen seines Materials und aus statischen Gründen nicht abnehmen. Daher habe man sich für eine „visuelle Beseitigung“ entschieden.
Die Ausdrücke „Judensau“, „Saujude(n)“, „Judenschwein(e)“ oder „Schweinejude(n)“ gehören bis heute zum antisemitischen Vokabular, das auf die jahrhundertelange „Judensau“-Tradition zurückgeht. Sie sind fester Bestandteil der verbreiteten Schändung jüdischer Friedhöfe. Es sind nach deutschem Strafrecht eindeutig strafbare Beleidigungen. Sie gehen über gewöhnlichen Fremdenhass hinaus, da sie Personen in antisemitischer Tradition gezielt als Angehörige eines Kollektivs entmenschlichen, herabsetzen und bedrohen.
Seit 1989 nahmen solche Straftaten in Deutschland zu; einige wurden öffentlich stärker beachtet. So wurde das gemeinsame Grab von Bertolt Brecht und Helene Weigel, die jüdischer Herkunft war, kurz nach Öffnung der Berliner Mauer mit der Parole „Sau-Jude“ beschmiert. Am 20. April 1992, dem Jahrestag des „Führergeburtstags“, und am 20. Juli 1992 warfen Neonazis Schweineköpfe vor die Erfurter Synagoge. Auf dem beim zweiten Mal beigefügten Zettel stand: „Dieses Schwein Galinski ist endlich tot. Noch mehr Juden müssen es sein.“ Heinz Galinski, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, war am Vortag gestorben. Im Oktober 1993 wurde das Mahnmal zu deportierten Juden in Berlin-Grunewald mit Schweineköpfen geschändet. 1993 in Marl beschimpfte ein Skinhead einen Obdachlosen als „Judensau“ und schlug ihn so hart, dass er bewusstlos wurde und drei Monate später im Krankenhaus starb. Der Täter erhielt eine Jugendstrafe von 15 Monaten Haft. Seine Tat wurde erst 2009 staatlich als rechtsextrem motiviert anerkannt. 1997 rief die rechtsextreme Gruppe Blood and Honour in Altenburg zur Ermordung des als „korrupte Judensau“ bezeichneten Oberbürgermeisters und sechs weiterer Personen auf. Im Oktober 1998, als Martin Walser mit Ignatz Bubis um die angebliche „Moralkeule Auschwitz“ debattierte, trieben Neonazis ein Ferkel mit einem aufgemalten Davidstern und dem Namen von Ignatz Bubis über den Alexanderplatz in Berlin. Am 22. November 1999 forderte Meir Mendelssohn, der das Grab von Bubis in Israel mit Farbe übergossen hatte, das Publikum bei einem Theaterabend der Volksbühne Berlin auf, „… das Wort Judensau zu sagen, ganz normal und ganz natürlich.“ Er wurde wegen Volksverhetzung angezeigt.
Im Juni 2006 beschimpfte der Schweizer Neonazi Pascal Lüthard einen Restaurantgast als „Judensau“. Er erhielt dafür gemäß der Schweizer Rassismus-Strafnorm eine Geldstrafe, weil (so das Obergericht Bern nach seinem Revisionsantrag) ihm die jüdische Identität des Opfers bekannt war, so dass sein Ausspruch über eine Einzelperson hinaus eine Ethnie und Religion gewollt herabgesetzt habe. 2008 bestätigte die dritte Instanz das Urteil des Obergerichts.
Am 16. April 2010 beschimpfte ein ortsbekannter Rechter in Laucha einen gebürtigen Israeli und Enkel eines Holocaustüberlebenden als „Judenschwein“, schlug und trat ihn schwer.
Rechtsradikale Fußballstadienbesucher beschimpfen und bedrohen als jüdisch angesehene Fußballer und Schiedsrichter in Deutschland seit Jahrzehnten mit solchen Ausdrücken. 2006 beschloss der Verband Makkabi Deutschland, Spiele deutschjüdischer Vereine bei solchen Vorfällen künftig abzubrechen und vor Sport- und Strafgerichte zu bringen. Infolge der ausgelösten Debatte nahm der DFB zwei Jahre darauf „Beleidigungen (§ 185 StGB) aus rassistischen bzw. fremdenfeindlichen Motiven“ als Grund für unbefristete Stadionverbote in seine Richtlinien auf. Die Beschimpfung „Judensau“ fällt unter die Diskriminierungsverbote des DFB, die Ausbilder, Schieds- und Strafrichter durchsetzen sollen. Antisemitische Beschimpfungen in deutschen Stadien werden jedoch statistisch kaum erfasst und besonders auf Vereinsebene nur selten verfolgt.
Manche antisemitisch eingestellte Muslime beschimpfen Juden als „Affen und Schweine“. Sie berufen sich dazu auf drei Suren des Koran (2,65; 5,60; 7,166), nach denen Allah frevelnde Menschen, im Kontext Juden und Christen, in Affen und/oder Schweine verwandelt haben soll. Die Suren werden ähnlich wie prophetische Bibelstellen als zeitbedingte Vorwürfe an die Mehrheit der Juden gedeutet, nicht gottesfürchtig zu sein. Die Akademie für islamische Untersuchungen der al-Azhar-Universität beschloss 2003, diese Stellen nicht mehr gegen heutige Juden zu verwenden.
Ab November 2022 nahm antisemitische und rassistische Hetze, darunter das Schimpfwort „Judensau“, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprunghaft zu. Zuvor hatte der Milliardär Elon Musk das Unternehmen gekauft und viele Mitarbeiter entlassen, die für die Moderation der Tweets nach internen und externen Regeln verantwortlich waren.
Der Rockmusiker Roger Waters ließ in jeder Bühnenshow seiner Tournee „The Wall“ (2010–2013) einen Ballon in Gestalt eines Schweins aufsteigen, bemalt unter anderem mit dem Davidstern. Auf Kritik erklärte er, das Schwein symbolisiere „das Böse“ und der Stern legitime Kritik am Staat Israel. Doch es wurde als Rückgriff auf die bekannte Symbolik der „Judensau“ und daher als antisemitisch eingestuft.
Bei der documenta fifteen 2022 in Kassel zeigte das indonesische Künstlerkollektiv „Taring Padi“ ein detailreiches Wandgemälde, darauf ein Soldat mit Schweinsgesicht und Davidstern, der einen Helm mit der Aufschrift „Mossad“ trägt, und einen orthodox gekleideten Juden mit Schläfenlocken, spitzen Zähnen und SS-Runen auf der Kopfbedeckung. Diese Symbole wurden als eindeutig antisemitisch kritisiert und mit der „Judensau“ verglichen.
Zu mittelalterlichen Darstellungen
- Jörg Bielig, Johannes Block, Harald Meller, Ernst-Joachim Waschke (Hrsg.): Die „Wittenberger Sau“. Entstehung, Bedeutung und Wirkungsgeschichte des Reliefs der sogenannten „Judensau“ an der Stadtkirche Wittenberg. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle 2020, ISBN 3-944507-99-1 (Rezension von Klaus Graf auf archivalia.hypotheses.org, 25. September 2020)
- Birgit Wiedl: Laughing at the Beast. The Judensau. Anti-Jewish Propaganda and Humor from the Middle Ages to the Early Modern Period. In: Albrecht Classen (Hrsg.): Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times. Epistemology of a Fundamental Human Behavior, its Meaning, and Consequences. De Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 3-11-024547-7, S. 325–364 (PDF; 6,1 MB)
- Hermann Rusam: „Judensau“-Darstellungen in der plastischen Kunst Bayerns. Ein Zeugnis christlicher Judenfeindschaft. In: Evangelisch-Lutherischer Zentralverein für Begegnung von Christen und Juden (Hrsg.): Begegnungen. Zeitschrift für Kirche und Judentum 90, Sonderheft März 2007, ISSN 1612-4340 und ISSN 0083-5579.
- Heinz Schreckenberg: Die Juden in der Kunst Europas. Ein historischer Bildatlas. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, ISBN 3-525-63362-9, S. 343–349 („Das ‚Judensau‘-Motiv“).
- Petra Schöner: Judenbilder im deutschen Einblattdruck der Renaissance. Ein Beitrag zur Imagologie. Valentin Koerner, Baden-Baden 2002, ISBN 3-87320-442-8, S. 189–208 (Rezension).
- Claudine Fabre-Vassas: The Singular Beast. Jews, Christians, and the Pig. Columbia University Press, 1997, ISBN 0-231-10366-2 (englisch).
- Thomas Bruinier: Die „Judensau“. Zu einem Symbol des Judenhasses und seiner Geschichte. In: Forum Religion. Kreuz-Verlag Breitsohl, Stuttgart 1995, 4, S. 4–15, ISSN 0343-7744.
- Wilfried Schouwink: Der wilde Eber in Gottes Weinberg. Zur Darstellung des Schweins in Literatur und Kunst des Mittelalters. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1985, ISBN 3-7995-4016-4, S. 75–88.
- Isaiah Shachar: The Judensau. A Medieval Anti-Jewish Motif and its History. Warburg Institute, London 1974, ISBN 0-85481-049-8 (PDF)
- Bernhard Blumenkranz: Juden und Judentum in der mittelalterlichen Kunst. Kohlhammer, Stuttgart 1965.
- David Kaufmann: Die Sau von Wittenberg. (1890) In: Gesammelte Schriften Band 1, Frankfurt am Main 1908, S. 161 ff. (Volltext online).
Zu antisemitischen Karikaturen
- Eduard Fuchs: Die Juden in der Karikatur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. (1921) Nachdruck: Adrian Schelm, Leipzig 2018, ISBN 3-947190-11-5 (Volltext online).
- Julius H. Schoeps, Joachim Schlör (Hrsg.): Bilder der Judenfeindschaft. Antisemitismus, Vorurteile und Mythen. Bechtermünz, Augsburg 1999, ISBN 3-8289-0734-2.
- Angelika Plum: Die Karikatur im Spannungsfeld von Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. Eine ikonologische Untersuchung zu Feindbildern in Karikaturen. Berichte aus der Kunstgeschichte. Shaker, Aachen 1998, ISBN 3-8265-4159-6.
- Michael Wolffsohn: Das Bild als Gefahren- und Informationsquelle. Von der „Judensau“ über den „Nathan“ zum „Stürmer“ und zu Nachmann. In: Uwe Backes, Eckhard Jesse, Rainer Zitelmann (Hrsg.): Die Schatten der Vergangenheit. Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus. Ullstein, Berlin 1992, ISBN 3-548-33161-0, S. 522–542.
- Stefan Rohrbacher, Michael Schmidt: Judenbilder. Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer Vorurteile. Rowohlt, Reinbek 1991, ISBN 3-499-55498-4.
- Matthias Beimel: Die Karikatur als Ersatzhandlung. Antisemitismus in der NS-Propaganda und ihre Vorbilder. In: Geschichte lernen. Friedrich, Velber 3/1990, Heft 18, Klett, Stuttgart 1990, ISSN 0933-3096, S. 28–33
- Barbara Schneider: Tödliche Wirkung. Tief sitzender Judenhass hat sich in der christlichen Kunst vielfach niedergeschlagen. Zeitzeichen.net, 2020
- Daniel N. Leeson: Judensau 2010. Journal for the Study of Antisemitism Band 2, Ausgabe 2, Dezember 2010
- Andrea-Martina Reichel: Die Kleider der Passion. Für eine Ikonographie des Kostüms. Humboldt-Universität zu Berlin, 1998 (PDF, intern S. 122–130)
- Oliver Gußmann: Das sogenannte „Judensau“- Motiv – eine Kurzinformation.
Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Judensau by Wikipedia (Historical)
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou